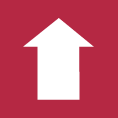Klienteninfo Ausgabe 50 / März 2025
Inhalt:
- Hohes Risiko: Verarbeitung personenbezogener Daten in den USA
- Gruß vom Murmeltier: Messenger-Überwachung im österreichischen Regierungsprogramm
- Gerhart Baum: Ein engagierter Datenschützer verstarb 92jährig am 15.2.2025
- Kinder-Apps spionieren
31.03.2025
Herzogbirbaum 110
2002 Großmugl
Hohes Risiko: Verarbeitung personenbezogener Daten in den USA
Hat die Regelungswut des gegenwärtigen US-Präsidenten Auswirkungen auf den Datenschutz? Die Antwort lautet: Ja, selbstverständlich. Das betrifft viele Bereiche, vorallem aber die Frage, wie weit man sich als Anwender von Software und als Verantwortlicher einer Datenverarbeitung darauf verlassen kann, dass die eigenen Daten in den USA sicher sind. Auf diese Frage wird auch die EU-Kommission bald eine neue Antwort finden müssen, denn immerhin hat sie ja mit der "Angemessenheitserklärung" vom 10. Juli 2023 erklärt, dass man aus der EU personenbezogene Daten zur Verarbeitung in die USA weiterleiten darf.
Der gegenwärtige US-Präsident stürzt die USA in einen "undefinierten Betriebszustand" und legt die Axt an die rechtsstaatlichen Elemente der Weltordnung. Nicht mehr internationale Verträge regeln das Verhältnis zwischen souveränen Staaten, sondern das Recht des Stärkeren. Die Europäische Union muss ihre strategische und politische Ausrichtung neu definieren, um mit einem unberechenbaren, aber mächtigen politischen Führer umgehen zu können.
Schon bisher war es den US-Geheimdiensten auf Basis der US-Gesetzgebung gestattet, auf die in Europa geschützten Personendaten zuzugreifen, ohne dass es für die Betroffenen befriedigenden Rechtsschutz gab. Die vormals legale Maßnahme könnte jetzt durch systematischen politischen und/oder wirtschaftlichen Druck (oder Erpressung?) noch verschärft werden.
Was sollte man tun?
Man sollte entschlossen, aber nicht überhastet reagieren. Es wäre anzustreben, Schritt für Schritt wieder die vollständige Autonomie bei der Verarbeitung seiner Daten zu erlangen. Leider haben es viele Menschen in der Vergangenheit versäumt, sich davon ein Bild zu machen, wie weit sie durch Einsatz der von ihnen gekauften Hard- und Software bereits von externen Systemen abhängig sind, auf die sie keinen Zugriff haben. Dies gilt es zunächst zu analysieren.
Gerade bei der Verarbeitung besonders sensibler Daten (Art. 9 und 10 DSGVO), z.B. Diagnosen von Krankheiten oder Inhalte behördlicher Verfahren, sollte man technische Lösungen von Unternehmen bevorzugen, die nicht durch US-Behörden zur Herausgabe von Daten genötigt werden können. Denken Sie bitte auch daran, dass zahlreiche Geräte weltweit nur funktionieren, solange sie mit Rechnern in den USA verbunden sind. Gerade wenn man ein Unternehmen vertritt, das schon länger am Markt ist, wird es in der Praxis schwierig sein, sich "über Nacht" gänzlich von Werkzeugen zu befreien, deren Betreiber von der US-Administration zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden können. In kleinen Schritten sollte man es dennoch versuchen, um zu vermeiden, dass die Politik der USA u.U. das Überleben des eigenen Betriebes gefährden kann.
Open-Source-Software bietet ganz generell jedenfalls eine gute Perspektive. Zwar werden sich nicht alle Aufgaben mit offener Software lösen lassen. Je geringer jedoch die eigene Abhängigkeit von Entscheidungen ausfällt, die in den USA oder anderswo getroffen werden, desto einfacher könnte es gelingen, die kommende, schwierige Zeit wirtschaftlich und juristisch zu überdauern. Auch die Amtszeit des 47. US-amerikanischen Präsidenten wird irgendwann enden. Zu hoffen ist, dass es die nächste Regierung schafft, das bis dahin entstandene Chaos, die Nachteile für die globale Entwicklung und auch die in den USA für die dortige Bevölkerung entstandenen Schäden rasch zu beseitigen.
Detailierte Empfehlungen für Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit können selbstverständlich nur aufgrund der individuellen Situation erarbeitet werden. Ideato hilft Ihnen dabei sehr gerne.
Herzogbirbaum 110
2002 Großmugl
Gruß vom Murmeltier: Messenger-Überwachung im österreichischen Regierungsprogramm
Das Attentat von Villach am 15.2.2025 hat eine Erneuerung des Wunsches der Österreichischen Volkpartei (ÖVP) gebracht, dass die Polizei verschlüsselte Messengernachrichten mitlesen kann. Das Vorhaben hat es bis in die Koalitionsvereinbarung mit SPÖ und NEOS geschafft und soll (nach Maßgabe der Vereinbarkeit mit der Verfassung) rasch umgesetzt werden. Das Murmeltier grüßt also wieder. Dazu sollte festgehalten werden:
- Bereits ein Mal wurde ein gleichartiger Versuch der österreichischen Bundesregierung vom Verfassungsgerichtshof für unzulässig erklärt.
- Soferne nicht eine anlasslose Massenüberwachung geplant ist, hätte das Vorhaben das Attentat von Villach nicht verhindert. Nach dem derzeit bekannten Stand der Erhebungen war der Attentäter von Villach vor seiner Tat absolut unauffällig, seine Kommunikation wäre also kaum gezielt überwacht worden. In diesem Punkt unterscheidet sich der Fall von vielen anderen, bei denen Attentate verübt wurden, obwohl die Täter polizeibekannt waren, jedoch trotz alarmierender Signale nicht mit der notwendigen Sorgfalt unter der gesetzlich möglichen, ja sogar gebotenen Beobachtung gehalten wurden. Die erschreckenden Nachlässigkeiten der Behörden, die nach dem Anschlag von Wien am 2. November 2020 aufgedeckt wurden, können hier als ein Beispiel unter weltweit vielen angeführt werden.
- Die Radikalisierung des Täters von Villach hat - Behördenaussagen zufolge - auf TikTok stattgefunden. Die Polizei hätte also von sich aus schon früher an die Wurzel des Übels herangehen können. Zum Ausschalten der "Influenzer", die mittels Hassbotschaften junge Menschen zum Terrorismus drängen, hätte es lediglich eines Accounts auf TikToc, arabischer Sprachkenntnisse und des notwendigen behördlichen Engagements bedurft - keinesfalls einer Gesetzesänderung. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verfolgung von Radikalisierungsbotschaften gibt es bereits. Mühe bereitet allenfalls die erforderliche internationale Kooperation, das sollte aber - so meint man - kein Hindernis sein.
- Solange sich zuvor unauffällige Einzelpersonen "im stillen Kämmerlein" isoliert, unerwartet und in kurzer Zeit durch Hassbotschaften verbrecherischer "Influenzer" zu Überzeugungstätern wandeln, werden ihre Taten wohl durch keine Polizeiarbeit eines demokratischen, liberalen Rechtsstaates zu verhindern sein. Diese unangenehme Wahrheit müssten Politiker öffentlich einbekennen, sofern sie nicht eine schleichende Entwicklung hin zu einem Polizeistaat und zu den dazugehörigen totalitären Überwachungs- und Unterdrückungsmethoden mindestens dulden wollen. Publikumswirksame Anlassgesetzgebung war in der Sache noch nie zielführend.
- Dass Sicherheitsbehörden einzelner Staaten immer wieder ihnen bekannte, untrügliche Anzeichen für das unmittelbare Bevorstehen verbrecherischer Akte ignoriert oder falsch bewertet haben, ist massenhaft dokumentiert und kann durch den Eingriff in die Messenger-Verschlüsselung nicht verhindert werden. Wer auf der Suche nach der Nadel den Heuhaufen vergrößert oder aber gar nicht in der Lage ist, eine Nadel zu erkennen, kann nicht hoffen, die Aufgabe dadurch besser lösen zu können.
Wie geht es weiter?
Vermutlich wird die Regierung dem Parlament in nächster Zeit einen Gesetzesvorschlag zur Realisierung des Vorhabens "Messengerüberwachung" vorlegen. Dieser Vorschlag wird wahrscheinlich mit der Regierungsmehrheit beschlossen. Sobald das Gesetz in Kraft ist, darf die Polizei technisch in die verschlüsselte Kommunikation eindringen. Das wird sie auch tun. Doch ist davon auszugehen, dass unmittelbar mit dem Gesetzesbeschluss auch Beschwerden vor dem Verfassungsgerichtshof erhoben werden, der ein gleichartiges Regierungsvorhaben schon einmal als verfassungswidrig aufgehoben hat. Eine Entscheidung könnte einige Jahre in Anspruch nehmen. In dieser Zeit wird die Polizei jedoch die neuen Möglichkeiten nützen, selbst für den Fall, dass sie nachträglich als verfassungswidrig untersagt werden.
Quellen:
https://www.derstandard.at/story/3000000257675/die-gefahr-der-islamistischen-tiktok-prediger-fuer-die-jugend
https://www.derstandard.at/story/3000000257649/die-krux-mit-karners-anlassloser-massenueberpruefung(17.2.2025)
Prantl, Heribert: Der Terrorist als Gesetzgeber. Wie man mit Angst Politik macht. München (Droemer), 2008.
Herzogbirbaum 110
2002 Großmugl
Gerhart Baum: Ein engagierter Datenschützer verstarb 92jährig am 15.2.2025
Gerhart Baum machte sich in seiner eigenen Partei, der FDP, nicht nur Freunde. Lebenslang wies er, auch als Bundesinnenminister in Deutschland, auf die Gefahren der Überwachung für den Rechtsstaat und die Demokratie hin. Die parlamentarische Mehrheit im Bundestag machte trotzdem den Weg frei für den Staatstrojaner und andere problematische Maßnahmen. Davon hat sich der Verstorbene stets distanziert und sich dabei auf sein Bekenntnis zu den Grundrechten, zum demokratischen Rechtsstaat und auf die Logik des Datenschutzes berufen. In allen seinen Funktionen, auch als Rechtsanwalt, hat er sich bis zuletzt dafür eingesetzt, das allgemeine Bewußtsein für die Wichtigkeit des Datenschutzes zur Stärkung der Demokratie zu fördern.
Quelle:
https://netzpolitik.org/2025/nachruf-gerhart-baum-datenschuetzer-aus-ueberzeugung/?utm_source=firefox-newtab-de-de(16.2.2025)
Herzogbirbaum 110
2002 Großmugl
Kinder-Apps spionieren
Kürzlich wurde darüber berichtet, dass es für die Smartphones spezielle Apps gibt, mit denen Eltern ihre Kinder ständig überwachen können. Je nach Software ist der Neugierde der Eltern kaum eine Schranke gesetzt. Das Tracking des Schulweges ist in allen Angeboten enthalten. Mithören von Unterhaltungen ist auch oft möglich. Ähnliche Angebote gibt es auch als "Notrufuhren" für Senioren, jedoch kann zwischen beiden Anwendungen ein juristisch großer Unterschied bestehen.
Die gängigen Modelle der "Notrufuhren" sind dann rechtskonform, wenn der Betroffene zu seiner eigenen Sicherheit bereit ist, in schwierigen Lagen seine Standortdaten einem vorher von ihm ausgewählten Personenkreis zu übermitteln und seine Kontaktpersonen automatisiert anzurufen. Sofern es sich um Personen mit gravierenden Einschränkungen handelt, trifft der Erwachsenenhelfer die Entscheidung.
Die Apps zur "Kindererziehung" hingegen werden durch die Eltern ferngesteuert. Solange die Kinder das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird von ihnen keine Zustimmung erforderlich sein, sofern sich das Gerät darauf beschränkt, Standortdaten zu übermitteln. Problematisch könnte in jedem Fall das heimliche Mithören von Gesprächen sein. Die Gesprächspartner oder ihre Erziehungsberechtigten (sofern es sich um andere Kinder handelt), müssten ausdrücklich zustimmen, ebenfalls abgehört zur werden. Das wird nur in seltenen Fällen möglich sein.
Eine mögliche Lösung des juristischen Problems könnte darin bestehen, mit den Kindern vorab ausführlich über die Dinge zu reden. Wenn die Kinder von sich aus mit ihren Eltern angemessenen telefonischen Kontakt halten, erübrigt sich das ferngesteuerte "Abhören".
Je früher in Kindern das Bewußtsein dafür geweckt wird, dass der Einsatz von Technik angenehme Wirkungen, aber auch "mögliche unerwünschte Wirkungen" hat und je früher sie verstehen, worin diese Auswirkungen bestehen, desto sicherer werden sie sich selbständig in der Gesellschaft der Zukunft bewegen können. Und so könnte man neben dem juristischen Problem auch gleich eine wesentliche Erziehungsaufgabe erfolgreich meistern.
Quelle:
https://www.derstandard.at/story/3000000262331/heimliches-abhoeren-apps-zur-kindersicherung-gefaehrden-privatsphaere(21.3.2025)
Herzogbirbaum 110
2002 Großmugl